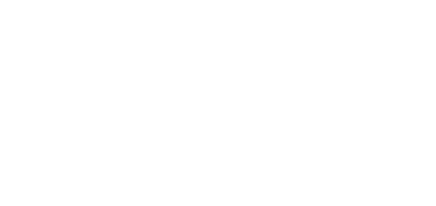Das United States Holocaust Memorial Museum entwickelte gemeinsam mit Historikern der Villa ten Hompel in Münster und zwei an die Villa delegierten Lehrerinnen dieses Bildungsprogramm.
Wie war der Holocaust möglich und wer war dafür verantwortlich? Angesichts dieser Frage geben viele Hitler und der Nazi-Elite die Schuld. Relativ wenige erkennen an, dass die Verbrechen am helllichten Tag, mitten in der Gesellschaft und mit dem Wissen, der Akzeptanz und sogar der Unterstützung einer Mehrheit der Bevölkerung geschehen sind. Von der Ausgrenzung bis zur Deportation, von der Unterdrückung bis zum Töten erforderte die Umsetzung der Nazi-Verbrechen eine aktive Beteiligung vieler Menschen auf verschiedenen Ebenen, und viele andere mehr, die zumindest gleichgültig gegenüber dem Leid ihrer Nachbarn waren.
Wie kann man sich mit den Auswirkungen einer solchen weit verbreiteten Duldung und Komplizenschaft bei Massenverbrechen auseinandersetzen? Unser Bildungsprogramm lädt die Teilnehmenden ein, zu erforschen, wie der Holocaust möglich war, sich dazu mit realen Fallbeispielen zu beschäftigen, die sich ergebenden Fragen zu diskutieren und ihre eigenen Ideen auszutauschen, während sie sich dieser herausfordernden Vergangenheit stellen. Das Programm stützt sich auf Archivfilme, Analysen historischer Fotos sowie die Erforschung lokaler Kontexte in begleiteten Rundgängen und in Workshops, die von den Teilnehmenden selbst geleitet werden.
Der Holocaust ist ein komplexes Ereignis, das sich monokausalen Erklärungen zu entziehen scheint. Dies würde zu allzu vereinfachenden Antworten führen. Wir stellen jedoch fest, dass Besucher ein tieferes Verständnis wünschen und dass das Eingehen auf ihre Interessen zu einem besseren Verständnis der Vergangenheit und Bedeutung von aktuellen gesellschaftlichen Konflikten führt.
Mit der Ausstellung Einige waren Nachbarn: Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand, möchte das United States Holocaust Memorial Museum das Verständnis von Jugendlichen und jungen Erwachsenen für die Rolle und das Handeln gewöhnlicher Menschen während der Zeit des Nationalsozialismus vertiefen. Das begleitende Bildungsprogramm setzt auf eine intensive Interaktion mit den BesucherInnen. Durch die gemeinsame Diskussion von Annahmen und Perspektiven, die Reflexion von Gedanken und Einsichten wird der Lernprozess gefördert.. Die TeilnehmerInnen entwickeln allmählich ihre Deutung des historischen Materials, indem sie auf Impulse der ModeratorInnen reagieren und eigene Fragen formulieren. Die Besuchergruppe untersucht gemeinsam, wie die Vergangenheit verstanden werden kann und welche Relevanz sie für die Gegenwart besitzt. Dazu bildet sie eine Gemeinschaft von Lernenden. Durch die offene Durchführung schwieriger Gespräche verbindet diese Vermittlungsweise Informationen zum Thema mit der Erfahrung, aktiv an der gemeinsamen Deutung mit anderen Teilnehmenden teilzuhaben.
Pädagogische Aktivitäten
Aktivität „Filmaufnahmen einer öffentlichen Demütigung“
Wir engagieren die Teilnehmenden, indem wir zwei Fragen stellen: 1) Wie war der Holocaust möglich? und 2) Welche Rolle spielten gewöhnliche Menschen dabei? Dann laden wir sie ein, ihre eigenen Hypothesen mit historischen Quellen niedrigschwellig zu testen: beispielsweise anhand von Filmaufnahmen einer öffentlichen Demütigung eines jungen Paares unter aktiver Beteiligung ihrer Nachbarn. Erfahren Sie mehr über die Aktivität „Filmaufnahmen einer öffentlichen Demütigung“.
Aktivität „Fotoanalyse -- Die Vergangenheit im Blick”
Wir ermutigen die Teilnehmenden zum Weiterdenken durch die genaue Beobachtung des individuellen Verhaltens und der Gruppendynamik, die sich ebenfalls in anderen in der Ausstellung dargestellten Szenen zeigen. In einer moderierten Gruppendiskussion untersuchen die Teilnehmenden sorgfältig die Fotografien und Fallstudien der Ausstellung, um historische Ereignisse zu kontextualisieren und ein tieferes Verständnis dafür zu entwickeln, welche Bedeutung die Beteiligung der gewöhnlichen Menschen daran für uns heute besitzt. Erfahren Sie mehr über die Aktivität „Fotoanalyse - Die Vergangenheit im Blick“.
Aktivität „Erkundung historischer Ereignisse vor Ort“
Wir nähern uns zudem der NS-Vergangenheit, indem wir Lokalgeschichten in Städten und Regionen erforschen, in der die Ausstellung zu sehen ist. Beim Besuch von Straßen und Plätzen in der Nähe des Veranstaltungsortes entdecken die Teilnehmenden Ereignisse, die sich in ihrer eigenen Stadt oder ihrem eigenen Dorf zugetragen haben. Und dies besonders an Orten, an denen heute oft reges öffentliches Leben herrscht. Erfahren Sie mehr über die Aktivität „Erkundung historischer Ereignisse vor Ort“.
Aktivität „Workshop geleitet von Teilnehmenden“
Wir fördern die weitere Reflexion durch moderierte Workshops. Die Teilnehmenden arbeiten in kleinen, unabhängigen Gruppen zusammen, um spezifische Fallstudien zu untersuchen, diese den anderen TeilnehmerInnen vorzustellen und auftretende Probleme zu diskutieren. Erfahren Sie mehr über die Aktivität „Workshop geleitet von Teilnehmenden“.
Unterstützung Für Veranstaltungsorte
Wir bieten im Rahmen von Schulungen und Unterstützungstreffen, Programmleitfäden und Protokolle für RundgangsleiterInnen an, um die oben beschriebenen interaktiven Sequenzen zu gestalten und durchzuführen. Dies hat sich als hilfreich erwiesen, um die ModeratorInnen partizipativ in die künftige Arbeit mit der Ausstellung einzubinden. Auf diese partizipative Weise werden zugleich die Prinzipien und Grundlagen unseres pädagogischen Ansatzes vermittelt.